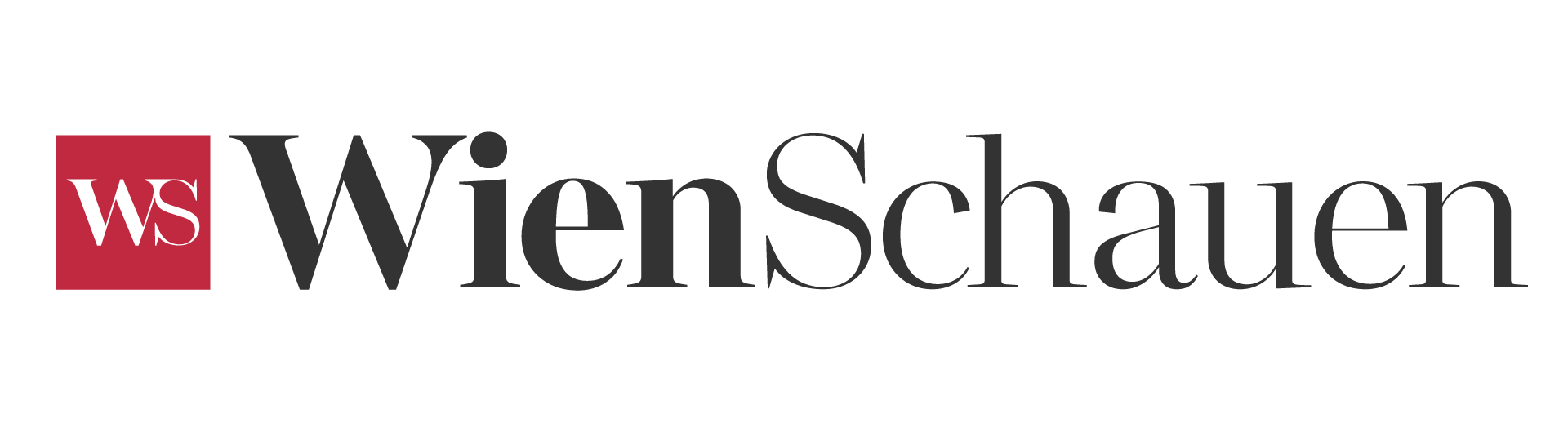Fasanviertel: Stadtteil ohne Stadtplatz
Das Fasanviertel liegt zwischen Rennweg, Gürtel und den Bahngleisen, die zum Hauptbahnhof führen. 28 Hektar groß, dicht bebaut, nur wenige Straßenbäume – und nirgends ein größerer Platz. Das Viertel neben Schloss Belvedere und Botanischem Garten ist zudem eine ausgewiesene Hitzeinsel (siehe Hitzekarte von 2019). Die öffentlichen Räume sind mehrheitlich asphaltierte Flächen.
Die zentrale Straße des Viertels ist die Fasangasse (Foto unten), die Gürtel und Ungargasse verbindet. Sie firmiert – kein Witz – offiziell als „Flaniermeile“.
Im Norden des Fasanviertels, gegenüber dem Bahnhof Rennweg, liegt der Fasanplatz. Um den Platz dominieren Gebäude der Gründerzeit (auf dem unteren Foto links und rechts) und ein großer Gemeindebau aus den 1930ern (Mitte).
Nachdem es im ganzen Fasanviertel keinen autofreien Platz gibt, könnte die Vermutung naheliegen, es sei sicherlich alles getan worden, um zumindest einen größeren Platz möglichst einladend zu gestalten. Weit gefehlt! Der Fasanplatz ist nicht viel mehr als ein Autoabstellplatz. Ein Freiraum zum angenehmen Aufenthalt, zum Kaffeetrinken, zum Einkaufen usw. – also ein klassischer Stadtplatz – ist er nicht. Alleine die Verteilung der Verkehrsflächen (siehe unten) verhindert eine zeitgemäße urbane Nutzung.
Kreisverkehr als Grätzlzentrum
Wo Rennweg und Fasangasse aufeinandertreffen, ist ein Kreisverkehr eingerichtet. Also genau an jenem Punkt, an dem das Passantenaufkommen am größten ist und ein logisches Zentrum zu erwarten wäre. An der Ecke übrig bleibt eine isolierte Gehsteigfläche um einen Imbissstand und eine Straßenbahnhaltestelle.
Parkplatz statt echter Platz
Entstanden ist der Fasanplatz durch die Überplattung der hier befindlichen Bahngleise. Diese bauliche Situation verhindert zwar die Errichtung eines Parks, steht aber einer attraktiven Platzgestaltung nicht im Weg. Denn was Wien braucht, sind funktionierende Stadtplätze. Grünflächen – so wichtig sie auch sind – gibt es in der weiteren Umgebung bereits einige: den Park vom Schloss Belvedere, den Botanischen Garten, den Schweizer Garten (beim Arsenal) und künftig auch die Grünflächen im Stadtentwicklungsgebiet nebenan (Eurogate bzw. Village im Dritten). Viel zu tun gibt es hingegen im Inneren des Fasanviertels, wo Bäume in den meisten Straßen und Gassen fehlen und der Versiegelungsgrad sehr hoch ist.
Die dichte Bebauung und die damit einhergehende hohe Bevölkerungsdichte im Umfeld sind die idealen Voraussetzungen für einen größeren autofreien Platz mit der entsprechenden Nutzung und Gestaltung. Ein Platz für den konsumfreien Aufenthalt, für einen Markt, für Cafés und vielleicht auch als Ort für Kunst und Kultur. Ausreichend Fläche wäre vorhanden, potenzielle Nutzer bzw. Kunden ebenfalls.
Ränder: Fahrbahnen und Parkplätze
Der Fasanplatz besteht aus einer erhöhten Mitte – darunter sind die Bahngleise – und Straßen auf beiden Seiten, also vor den angrenzenden Häusern. Die Mitte dient vor allem als Parkplatz, auf den Seiten kann gefahren und geparkt werden. Einige Bäume und Kletterpflanzen lockern das Gesamtbild auf, können aber über den Mangel an Bäumen nicht hinwegtäuschen. Die Ränder des Platzes würden sich für Begrünungsmaßnahmen anbieten.
Fahrbahnen und Parkplätze sind an einigen Stellen asphaltiert, weite Flächen aber auch gepflastert (mit Betonstein, nicht Naturstein).
Begrünung & Beleuchtung
Die Begrünung wird durch die Bahngleise unweigerlich erschwert, doch gibt es Klettergerüste und Seile für Pflanzen. Während die Kletterpflanzen an der nördlichen Mauer gut gedeihen, funktioniert die Bepflanzung anderswo weniger. Auf den Satellitenbildern der letzten Jahre sind die zwischen den Masten gespannten Seile zu keinem Zeitpunkt bewachsen zu sehen. Unabhängig davon fallen Materialität und Farbwahl der Überbauung auf. Es bleibt, wie in Wien typisch, farblich monochrom. Die unschöne Alterung der Betonelemente ist auch schon unübersehbar.
Zur Beleuchtung kommen Laternen im üblich langweiligen Design zum Einsatz. Sie bilden zu den angrenzenden Häuserfassaden eher einen Kontrast als eine Entsprechung. Warum hier nicht zumindest ein gewisser Farbakzent (dunkelgrün?) gesetzt wurde, anstatt des immergleichen silbergrauen Einheitsbreis? Gerade in einer Stadt, die ohnehin schon so grau ist, müsste endlich eine Wendung hin zu freundlicheren Farben im öffentlichen Raum erfolgen. Generell beherrscht man in Wien weder das Bauen von repräsentativen Stadtplätzen, noch die Ausstattung und Ausschmückung mit den „kleinen Dingen“ (attraktive Bodenbeläge, Laternen, Sitzbänke, Mistkübel usw.).
Radweg
Auf dem Fasanplatz verläuft einer der kürzesten baulich ausgeführten Radwege Wiens.
Der Parkplatz ist zugleich eine Fahrradstraße. Dass der Radverkehr berücksichtigt wird, ist sehr positiv. Aber warum verläuft der Radweg genau an dieser Stelle? Anstatt die Platzmitte von fahrenden und parkenden Fahrzeugen freizuhalten und den Radweg auf einer Seite, an der Häuserzeile, entlangzuführen, wird der mittige Freiraum für den Verkehr hergegeben.
Nicht immer ein Platz
Wo heute der Fasanplatz ist, waren um die Jahrhundertwende offene Bahngleise. Ein beeindruckendes Detail auf dem Bild unten sind die Straßenlaternen. Die oben erwähnten „kleinen Dinge“ im öffentlichen Raum waren in Wien nicht immer so lieblos wie heute.
Die Kreuzung von Fasangasse und Rennweg war einst eine ansehnliche Verkehrsfläche. Vor dem Aufkommen des Automobils war der Straßenraum quasi eine unausgesprochene Begegnungszone – Fußgänger konnten die Fahrbahn überall betreten.
Ein neuer Fasanplatz?
Hier einige Ideen, wie der Platz umgestaltet werden könnte:
- Entfernung der Parkplätze, zum Ausgleich Schaffung von Anrainerparkplätzen in der weiteren Umgebung
- Entfernung des Kreisverkehrs
- Verlegung des Radwegs auf den nördlichen Rand des Platzes (Aspangstraße), was gewisse Umbauten erfordert
- Baumreihen und Entsiegelung vor den Häuserzeilen auf beiden Seiten (Aspangstraße, Obere Bahngasse)
- Keine unbedingte Pflanzung von Bäumen in Trögen in der Platzmitte („Alibi-Begrünung“ aufgrund fehlenden Kontakts zum Erdreich muss nicht sein)
- Freihaltung der Platzmitte für Fußgänger usw.
- Einrichtung dauerhafter Marktstände
- Nutzung für temporäre künstlerische Initiativen
- Einheitliche Pflasterung des gesamten Platzes
- Ersetzung der Laternen durch ästhetisch anspruchsvollere Modelle
Darüber hinaus:
- Aktivierung der angrenzenden Erdgeschoßzonen
- Pflanzung von Bäumen in allen Straßen und Gassen des Fasanviertels
- Attraktivierung und Umgestaltung der Fasangasse: Pflanzung einer durchgehenden Allee, Pflasterung der Gehsteige, Reduktion von Parkplätzen, Aufstellen von Straßenlaternen in altem Design
Kontakte zu Stadt & Politik
www.wien.gv.at
post@bv03.wien.gv.at
+43 1 4000 03110
Die Bezirksvorstehungen sind die politischen Vertretungen der einzelnen Bezirke. Die Partei mit den meisten Stimmen im Bezirk stellt den Bezirksvorsteher, dessen Aufgaben u.a. das Pflichtschulwesen, die Ortsverschönerung und die Straßen umfassen.
- SPÖ: wien.landstrasse@spoe.at
- Die Grünen: landstrasse@gruene.at
- ÖVP: landstrasse@wien.oevp.at
- NEOS: wien@neos.eu
- FPÖ: ombudsstelle@fpoe-wien.at
- Links: kontakt@links.wien
(Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Mandate im Dezember 2020.)
- SPÖ: kontakt@spw.at, Tel. +43 1 535 35 35
- ÖVP: info@wien.oevp.at, Tel. +43 1 51543 200
- Die Grünen: landesbuero.wien@gruene.at, Tel. +43 1 52125
- NEOS: wien@neos.eu, Tel. +43 1 522 5000 31
- FPÖ: ombudsstelle@fpoe-wien.at, Tel. +43 1 4000 81797
(Die Reihung der Parteien orientiert sich an der Anzahl der Mandate im November 2020.)
Verfall und Abrisse verhindern: Gemeinsam gegen die Zerstörung! (Anleitung mit Infos und Kontaktdaten)
Quellen
- 3. Bezirk: Fasangasse – Bauliche Maßnahmen gegen Auswirkungen des Klimawandels und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Rathauskorrespondenz, 12.6.2020)
- Die Fasangasse wird zur Flaniermeile (meinbezirk.at, 15.6.2020)
WienSchauen.at ist eine unabhängige, nicht-kommerzielle und ausschließlich aus eigenen Mitteln finanzierte Webseite, die von Georg Scherer betrieben wird. Ich schreibe hier seit 2018 über das alte und neue Wien, über Architektur, Ästhetik und den öffentlichen Raum. WienSchauen hat auch einen Newsletter: